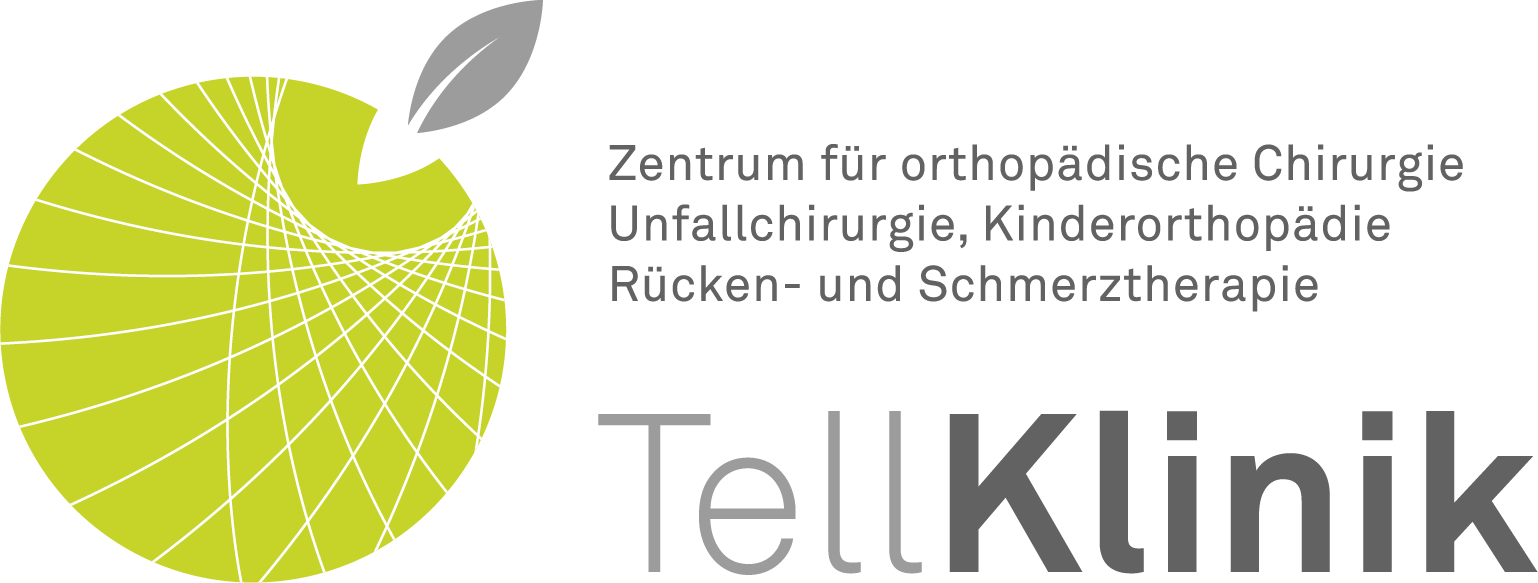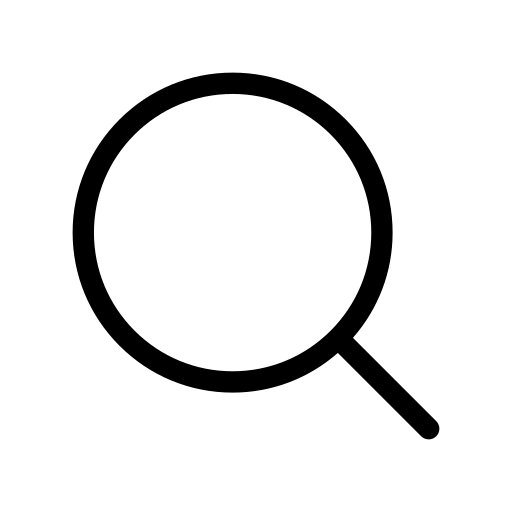Osteoporose
Ein wachsendes Gesundheitsproblem im Alter
Mit der steigenden Lebenserwartung nimmt auch das Risiko zu, im Alter an Osteoporose zu erkranken. Diese Knochenerkrankung und ihre Behandlung stellen zunehmend eine Herausforderung für das Gesundheitswesen dar. Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um geeignete Therapien einzuleiten und schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden.
Osteoporose betrifft vor allem das Stützskelett, insbesondere die langen Röhrenknochen wie den Oberschenkelknochen und die Wirbelsäule. Sie ist gekennzeichnet durch den schleichenden Abbau der stabilisierenden Knochenstruktur (Spongiosa), was das Risiko für Wirbelkörperfrakturen signifikant erhöht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Osteoporose als eine Abweichung von der Knochendichte eines gesunden 30-Jährigen, ausgedrückt im T-Score.
T-Score und Diagnose
Der T-Score wird durch die Messung der Knochendichte mittels Röntgenbild der Lendenwirbelsäule, Hüfte oder des Handgelenks ermittelt. Ein T-Score von über −1 gilt als normal, während ein Wert unter −2,5 auf Osteoporose hinweist. Bei Verdacht auf eine osteoporotische Fraktur sind neben der klinischen Untersuchung konventionelle Röntgenbildersowie gegebenenfalls eine MRI-Untersuchung der Wirbelsäule erforderlich, um das Ausmass der Verletzung und mögliche Nervenkompressionen zu beurteilen.
Oft wird die Osteoporose aber leider erst mithilfe eines osteoporotischen Knochenbruchs, zum Beispiel eines Wirbels, entdeckt.
Symptome und Ursachen
Typische Symptome der Osteoporose sind akute Rückenschmerzen, die plötzlich auftreten können und sich im Laufe der Zeit oft verstärken. In einigen Fällen können Bruchstücke des Wirbelkörpers auf Nerven drücken, was zu Gefühlsstörungen oder motorischen Ausfällen führt. Ein Wirbelkörperbruch kann bereits durch geringe Überbelastung oder Bagatelltraumata, wie forciertes Husten oder das Heben leichter Gegenstände, entstehen. Frauen sind aufgrund hormoneller Veränderungen in den Wechseljahren doppelt so häufig betroffen wie Männer.
In der Schweiz haben 50 % der 50-jährigen Frauen und 20 % der 50-jährigen Männer ein Risiko, eine Osteoporose bedingte Fraktur zu erleiden. Jährlich erleiden etwa 74.000 Personen eine solche Fraktur, darunter 11.000 Wirbelfrakturen.
Diagnostik
Bei Verdacht auf eine osteoporotische Fraktur erfolgt zunächst eine umfassende klinische Untersuchung. Anschliessend wird ein konventionelles Röntgenbild der schmerzhaften Wirbelsäulenregion angefertigt. Um das Alter der Fraktur besser beurteilen und mögliche Nervenkompressionen erkennen zu können, wird zusätzlich eine MRI-Untersuchung der Wirbelsäule durchgeführt. Die CT-Untersuchung spielt in der Diagnostik osteoporotischer Frakturen eine untergeordnete Rolle und wird nur selten eingesetzt. Bei Rückenschmerzen nach einem Bagatelltrauma sollte bei älteren Personen immer an eine osteoporotische Wirbelfraktur gedacht werden. Eine detaillierte klinisch-radiologische Abklärung ist wichtig, um eine individuell abgestimmte Therapie zu planen. Da es sich bei der Osteoporose um eine systemische Erkrankung des Stützskeletts handelt, sollte die Behandlung grundsätzlich im Rahmen eines multidisziplinären Ansatzes erfolgen.
Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlung von osteoporose bedingten Wirbelbrüchen sollte sowohl medikamentös als auch therapeutisch erfolgen. Zu Beginn werden die Blutwerte von Calcium, Vitamin D und anderen für die Knochengesundheit relevanten Faktoren bestimmt. Bei leichten Wirbelbrüchen kann ein Drei-Punkte-Korsett zur Unterstützung der Heilung eingesetzt werden, jedoch muss es mindestens sechs Wochen getragen werden. Meistens wird eine solche Therapieform gerade bei älteren Patienten nicht gut vertragen. Wenn die Beschwerden nicht abklingen oder sich verschlimmern, kann eine operative Intervention erforderlich sein. Je nach Ausmass der Keilwirbelbildung ist bereits früh an eine operative Lösung zu denken, um einen schmerzhaften Buckel, der im weiteren Verlauf die Entstehung weiterer Frakturen begünstigen kann, notwendig.
Operative Optionen
Bei der operativen Behandlung werden Verfahren wie Kyphoplastie und Vertebroplastie eingesetzt. Bei beiden Methodenwerden über kleine Einschnitte feine Kanülen in den Wirbelkörper eingeführt. Bei der Vertebroplastie wird Knochenzement in den gebrochenen Wirbel injiziert, während bei der Kyphoplastie der Wirbelkörper zunächst mit einem Ballonaufgerichtet und dann stabilisiert wird.
Beide Verfahren ermöglichen es den Patienten, schnell wieder mobil zu werden, und Studien zeigen, dass die Zementverstärkung bei umfangreicheren Brüchen bessere Ergebnisse liefert als eine alleinige Korsettbehandlung. Bei schweren Wirbelfrakturen kann eine Stabilisierung mit Schrauben notwendig sein.
Insgesamt ist es wichtig, Osteoporose ernst zu nehmen und frühzeitig zu handeln, um die Lebensqualität und Mobilität zuerhalten. Ein multidisziplinärer Ansatz in der Behandlung kann helfen, die bestmöglichen Ergebnisse für die Patienten zu erzielen.